ITS News 04/2024

Rechenpower für die Wissenschaft: ‘Festus’ startet an der Universität Bayreuth
Seit August befindet sich der neue Hochleistungsrechner 'Festus' vom BZ HPC (Forschungszentrum für wissenschaftliches Rechnen) in der Testphase. Das durch die DFG geförderte Cluster wurde nach den Bedürfnissen der 40 Mitglieder des BZHPC von Mitarbeitern des ITS konzeptioniert und gebaut. Es wird insbesondere für rechenintensive Forschungsprojekte zur elektronischen Struktur und Dynamik, Produkt- und Prozessoptimierung sowie zur KI-gestützten Analyse medizinischer Daten genutzt.
Wir haben einige Fragen an die Beteiligten zu diesem spannenden Projekt gestellt:
René Meißner, was waren die Hauptgründe für die Beschaffung eines neuen HPC-Clusters?René Meißner: Der Bedarf an Rechenleistung an der Universität Bayreuth ist stark gestiegen. Computer-gestützte Methoden sind kein Nischenthema mehr und werden in allen Fachbereichen genutzt. Dies hat zu einem steigenden Bedarf geführt, den die bisherigen Systeme nicht mehr decken konnten.
Welche neuen Möglichkeiten und Kapazitäten bietet das neue HPC-Cluster im Vergleich zum alten System?
René Meißner: Das neue Cluster bietet zusätzliche und schnellere Rechenressourcen. Bei einigen Anwendungen ist 'Festus' doppelt so schnell pro Core. Es bietet mehr Speicherkapazität und Ausfallsicherheit.
Zudem spart 'Festus' Energie, indem ungenutzte Teile abgeschaltet werden. Diese Vorteile kommen den Nutzenden und der Universität zugute. Weitere Verbesserungen wie topologie-sensitives Scheduling* sind für Spezialisten.
Herr Prof. Dr. Kümmel, was ist die Besonderheit des BZHPC und wie können Forschende, die nicht bei der Antragstellung beteiligt waren, den Rechner mitnutzen?
Prof. Dr. Stephan Kümmel: Die Besonderheit des BZHPC ist, dass in diesem Zentrum Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Grenzen von Lehrstühlen, Fachgruppen und Fakultäten hinweg gemeinsam Forschungsgroßgeräte beschaffen und nutzen. So werden Synergien gehoben und vorhandene Ressourcen im Sinne der Nachhaltigkeit optimal genutzt.
Von diesem Engagement profitieren zudem alle Forschenden der UBT, denn die Rechnersysteme können innerhalb eines Priorisierungssystems von allen genutzt werden.
Welche Ziele sollen mit dem neuen HPC-Cluster in Ihren Forschungsfeldern erreicht werden und welche Aufgaben wird es übernehmen?
Prof. Dr. Stephan Kümmel: Meine Arbeitsgruppe forscht im Bereich der Vielteilchen-Quantenmechanik. Der neue Cluster wird uns z.B. die Simulation der Energie- und Elektronen-Transferprozesse ermöglichen, die in lichtsammelnden Systemen, z.B. in der Photosynthese oder Photokatalyse, eine Rolle spielen. So hoffen wir, einen Beitrag zur Entwicklung neuer Materialien für eine nachhaltigere Energieversorgung zu leisten.
Herr Prof. Dr. Oberhofer könnten Sie bitte kurz Ihr Arbeitsgebiet nennen und erklären, warum Computing ein wichtiges Instrument Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit ist und wie sehr Sie 'Festus' dafür benötigen?
Prof. Dr. Harald Oberhofer: Wir arbeiten auf dem Gebiet der theoretischen Materialphysik, hauptsächlich am Verständnis von Ladungstransportprozessen in organischen und anorganischen Energiematerialien, und dem Design neuer Materialien. Dazu simulieren wir auf mikroskopischer Ebene die Einflüsse auf den Transport basierend auf sogenannter elektronischer Dichtefunktionaltheorie. Diese bedarf der numerischen Lösung komplexer Integrodifferenzialgleichungen was für die von uns betrachteten Materialien nur auf Hochleistungsrechnern möglich ist. Dank 'Festus' können wir einerseits größere (und damit realistischere) Simulationszellen betrachten und andererseits diese mit genaueren (und daher rechnerisch aufwendigeren) Methoden behandeln.
Was ist Ihr Arbeitsgebiet, Prof. Dr. Wilczek und warum ist Computing dafür wichtig? Welchen Beitrag kann 'Festus' dabei leisten?
Prof. Dr. Michael Wilczek: Zusammen mit meiner Gruppe erforsche ich verschiedene komplexe Systeme. Turbulenz ist dabei ein zentrales Thema. So untersuchen wir einerseits grundlegende Eigenschaften von turbulenten Strömungen, andererseits aber auch beispielsweise die Dynamik von Regentröpfchen in Wolken oder von Plankton im Ozean. Computersimulationen spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie helfen uns Phänomene besser zu verstehen und liefern Daten für weitergehende Analysen. Simulationen sind gewissermaßen unsere computergestützten Experimente.
Mit dem neuen Cluster 'Festus' haben wir die Möglichkeit, unsere Simulationen quasi im eigenen Hause durchzuführen. Das hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen können wir ohne lange Wartezeiten Ergebnisse erhalten und somit auch schnell neue Ideen für unsere Forschung entwickeln. Zum anderen haben wir einen direkten Draht zu den kompetenten Ansprechpartnern aus dem ITS, die uns bei unserer Arbeit unterstützen und 'Festus' auf unsere Bedürfnisse abstimmen können. 'Festus' ergänzt damit auf komplementäre Art und Weise überregionale Rechenzeitressourcen, die wir auch für unsere Arbeit nutzen.
Frau Prof. Dr. Vlot-Schuster, könnten Sie bitte Ihr Forschungsfeld nennen und kurz erläutern, warum Computing und 'Festus' für Ihre Arbeit wichtig sind?
Prof. Dr. Vlot-Schuster: Unser Team an der Professur für Genetik der Nutzpflanzen erforscht die molekularen Grundlagen der Krankheitsabwehr in Pflanzen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf dem sogenannten Priming. Dieser Prozess wird beispielsweise durch eine lokale Infektion eines Blattes ausgelöst und führt zu einem erhöhten Schutz der gesamten Pflanze gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern. Die genetischen Merkmale, die das Priming unterstützen, könnten genutzt werden, um den Pflanzenschutz zu verbessern und die Pflanzen an zukünftige Klimabedingungen anzupassen.
Für unsere Forschung verwenden wir RNA-Sequenzierungsdaten, um die Genexpression über das gesamte Genom der Pflanze hinweg zu analysieren. Kürzlich haben wir zudem eine Hochdurchsatz-Imaging-Anwendung im Gewächshaus am Campus Kulmbach installiert. Diese Anwendung erfasst automatisch wichtige Wachstumsparameter der Pflanzen, wie Höhe, Grünfärbung, projizierte Blattfläche und die daraus abgeleitete digitale Biomasse. Dies ermöglicht es uns, die digitalen Bilddaten zu analysieren und die Genexpression aus den RNA-Sequenzierungsdaten mit den Pflanzenphänotypen zu korrelieren. Dadurch können wir genetische Merkmale, die das Pflanzenwachstum unter Stress und Krankheitsdruck fördern, schneller identifizieren.
Wer hat Zugang zum HPC-Cluster und welche Voraussetzungen müssen Nutzende erfüllen?
René Meißner: Das HPC-Cluster soll ab Mitte Januar allen Universitätsangehörigen zur Verfügung stehen. Angehörige der Lehrstühle, die an der Beschaffung beteiligt waren, werden bei der Auftragsverarbeitung bevorzugt.
Wir danken für die Zeit und die spannenden Einblicke in das Projekt.
Wir freuen uns darauf, die Fortschritte und Erfolge von 'Festus' in den
kommenden Jahren zu verfolgen.
Falls Sie weitere Fragen zu HPC haben, kontaktieren Sie uns gerne unter folgender E-Mail-Adresse: hpc@uni-bayreuth.de


* Topologie-sensitives Scheduling optimiert die Aufgabenverteilung in einem HPC-System, indem es die physische und logische Anordnung der Recheneinheiten berücksichtigt.

Exklusive E-Books vom Herdt Verlag
Online-Anleitungen sind zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Der Herdt Verlag stellt Ihnen über 800 E-Books zur Verfügung, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern können. Die E-Books können sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen helfen, ihre Kenntnisse zu erweitern und neue Herausforderungen zu meistern.
Die Themen umfassen Windows, Microsoft Office und Teams und decken auch speziellere Bereiche wie Netzwerke, Programmierung und KI ab.
Die E-Books sind vollständig downloadbar und wurden teilweise mit Zusatzmedien wie Video-Tutorials, Beispielen, Lösungen oder Wissenstests erweitert. Schauen Sie auch mal beim Herdt Verlag vorbei – Sie werden überrascht sein, auf welch große Vielfalt Sie stoßen. Bitte beachten Sie, dass die Seite des Herdt Verlags nur über VPN erreichbar ist.

Kostenlose Hilfe bei Computerproblemen
Der Laptop startet nicht mehr? Die
externe Festplatte wird nicht mehr
erkannt? Selbst nach dem Schließen der 250 offenen Browser-Tabs ist der PC immer noch zu lahm?
Die PC-Garage des IT-Servicezentrums
bietet in solchen (und vielen anderen)
Fällen kompetente und schnelle Hilfe
– kostenfrei für alle Studierenden der Uni Bayreuth!
Eine Übersicht der Dienstleistungen der PC-Garage gibt es auf der ITS Website.
Kommt gerne zu unseren
Öffnungszeiten vorbei, einen Termin braucht ihr nicht:
Mo - Fr: 08:30 - 11:00 Uhr
Mo - Do: 13:30 - 15:30 Uhr
Raum: 3.2.U1.160 im ITS / NW2
oder schreibt uns eine Mail an
pc-garage@uni-bayreuth.de
Laptopsprechstunde
Vielleicht haben Sie schon von der Laptopsprechstunde gehört, aber wissen Sie, wobei Ihnen diese helfen kann?
Das Team der Laptopsprechstunde hat für Sie Anleitungen für die Einrichtung von eduroam, Office, VPN/Proxy, Mail, FollowMe-Printing und Zertifikaten erstellt.
Sollten Sie mit den Anleitungen nicht zurechtkommen, hilft Ihnen das Team der
Laptopsprechstunden per Mail oder während der Öffnungszeiten gerne weiter:
Mo - Fr: 08:30 - 11:00 Uhr & Mo - Do: 13:30 - 15:30 Uhr

KI-Schulungen im neuen Jahr
Das ITS bietet ab 2025 Schulungen für KI-gestützte Bild- und Textbearbeitung für Websiteredakteur:innen an. Der Kurs richtet sich an wissenschaftsstützendes Personal, das Webseiten mit dem CMS Fiona 7 pflegt. Neben Grundlagen zu KI-Einsatzszenarien und verschiedenen KI-Tools wird im praktischen Teil der Einsatz von Prompts zur Text- und Bildgenerierung geübt.
Die Anmeldung erfolgt über das E-Learning-System. Nach der Anmeldung muss ein Kurs-
termin ausgewählt werden. Die Plätze sind auf zwölf Teilnehmende pro Termin beschränkt.
Termine 2025
13.01.2025 / 9 – 11 Uhr
CMS-Schulung
Grundlagenschulung für Einsteiger
16.01.2025 / IT-Sicherheit Workshop
Zum sicheren Arbeiten für Studierende
und Mitarbeiter mit K11
22.01.2025 / 9 – 11 Uhr / KI-Schulung
KI-gestützte Bild- und Textbearbeitung
05.02.2025 / 9 – 11 Uhr / KI-Schulung
KI-gestützte Bild- und Textbearbeitung
13.02.2025 / 9 – 11 Uhr
CMS-Schulung
Grundlagenschulung für Einsteiger
Die Anmeldung ist in den jeweiligen Kursen über das E-Learning-System möglich.
Achtung: Geschenkkartenbetrug
Wir möchten erneut auf eine perfide Betrugsmasche aufmerksam machen, die aktuell
wieder vermehrt an unserer Universität auftritt: den sogenannten Geschenkkartenangriff. Trotz unserer regelmäßigen Warnungen kommt es leider immer wieder zu Vorfällen, bei denen Mitarbeitende auf diese Betrugsversuche hereinfallen.
Wie funktioniert der Geschenkkartenbetrug?
Die Betrüger geben sich in ihren E-Mails als Vorgesetzte oder vertrauenswürdige Personen aus, daher nennt man diese Betrugsmasche CEO Fraud. Unter einem Vorwand, wie z. B. einem dringenden Geschenk für einen Kollegen, werden Sie aufgefordert, Geschenkkarten zu kaufen und die Codes an die Betrüger zu übermitteln. Diese E-Mails wirken harmlos und enthalten keine schädlichen Anhänge oder Links. Der finanzielle Schaden entsteht erst, wenn die Codes weitergegeben werden.
Wichtige Hinweise zur Erkennung und Vermeidung
- Prüfen Sie die Absenderadresse: Achten Sie darauf, ob die E-Mail-Adresse mit der Ihnen bekannten Adresse übereinstimmt. Persönliche E-Mail-Adressen an der Universität haben in der Regel das Format: vorname.nachname@uni-bayreuth.de.
- Seien Sie besonders aufmerksam bei mobilen Geräten: Auf Smartphones und Tablets ist es oft schwieriger, gefälschte E-Mails zu erkennen.
- Verifizieren Sie die Anfrage: Fragen Sie bei dem vermeintlichen Absender auf einem anderen Weg, z.B. telefonisch, nach.
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen: Betrüger versuchen oft, durch Zeitdruck eine schnelle Reaktion zu erzwingen.
- Melden Sie verdächtige E-Mails: Nutzen Sie den Report-Mail-Button oder leiten Sie verdächtige E-Mails an its-security@uni-bayreuth.de weiter.
Neue Herausforderungen durch KI
Ein besonderes Augenmerk möchten wir auf die zunehmende Nutzung von Künstlicher
Intelligenz (KI) durch die Betrüger legen. Diese ermöglicht es ihnen, E-Mails in fehlerfreiem und gut verständlichem Deutsch zu verfassen. Dadurch wird es immer schwieriger, Phishing-Angriffe anhand von sprachlichen Fehlern oder ungewöhnlichen Formulierungen zu erkennen. Seien Sie daher besonders wachsam und verlassen Sie sich nicht allein auf sprachliche Merkmale, um die Echtheit einer E-Mail zu
beurteilen.
Was tun im Ernstfall?
Sollten Sie dennoch Opfer eines solchen Betrugs werden, wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Informationssicherheitsbeauftragten Ralf Stöber (Telefon: 3177,
E-Mail: isb@uni-bayreuth.de). Schnelle Information ermöglicht rasches Handeln und verhindert weiteren Schaden.
Bleiben Sie wachsam und schützen Sie sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen vor diesen hinterhältigen Angriffen.

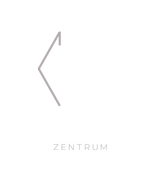
IMPRESSUM:
Herausgeber:
IT-Servicezentrum
Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30
95447 Bayreuth
Leitender Redakteur: Oliver Gschwender
Autoren: Oliver Gschwender,
Nadja Bursian
Gestaltung: Nadja Bursian
Fotos: René Meißner, Dominik Schramm,
Adobe Stock
